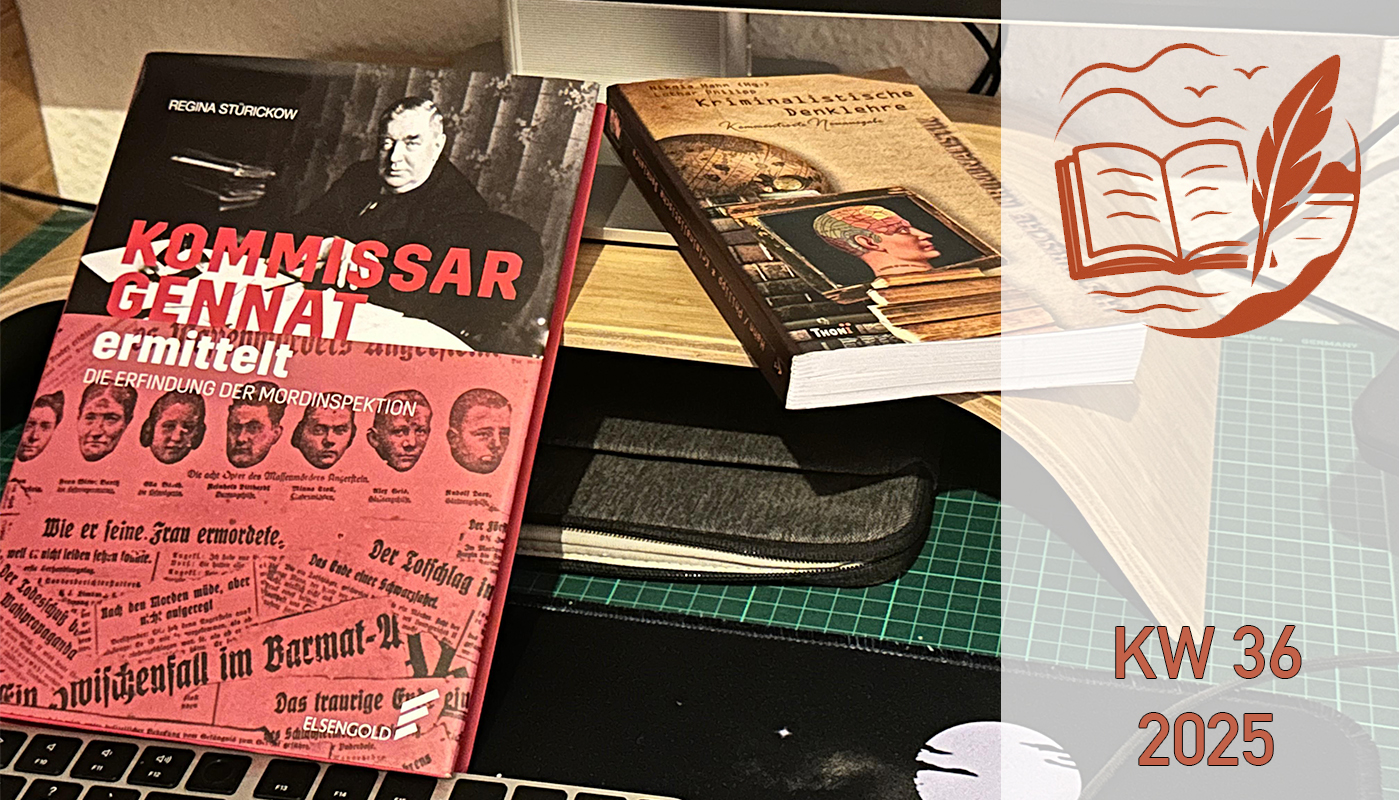In der vergangenen Woche prasselte das für drei Wochen pausierte Berufs- und Privatleben wieder voll auf mich ein. Neben dem Versenden der Rohversion an meine Lektorin, habe ich diese Woche daher keine großen Neuigkeiten zum Fortschritt zu machen.
Ich will aber auf ein Thema eingehen, was mir aus dem Umfeld meiner Familie und Freunde immer wieder hinsichtlich meines Romans begegnet: Wie hat denn die Polizei in den 1920er Jahren insgesamt überhaupt ermittelt? Gab es das damals schon in einer Form, die man mit der heutigen Kriminalpolizei vergleichen kann? Oder waren das eher wilde Anfangsjahre, in denen man sich mehr auf Zufälle und Geständnisse verlassen musste? Genau diese Fragen haben mich während meiner Romanarbeit natürlich auch beschäftigt, und je tiefer ich in die Materie eingetaucht bin, desto spannender wurde es.
Die kriminalistische Ermittlungsarbeit steckte in dieser Zeit tatsächlich noch in den Kinderschuhen, und viele Verfahren, die wir heute als selbstverständlich ansehen, wurden damals gerade erst entwickelt. Ein Buch, das mir bei der ersten Annäherung an das Thema geholfen hat und das ich daher jedem laienhaft Interessierten ans Herz legen möchte, ist Kommissar Gennat ermittelt von Regina Stürickow.
Der Name Ernst Gennat ist in diesem Zusammenhang untrennbar mit der frühen Geschichte der deutschen Kriminalpolizei verbunden. Oft wird er als “Vater der modernen Mordermittlung” bezeichnet. Er leitete ab 1926 die neugegründete “Mordinspektion” in Berlin und führte Methoden ein, die die Kriminalarbeit bis heute prägen. Statt auf das reine Bauchgefühl zu vertrauen, systematisierte er die Ermittlungen, führte Statistiken ein und war bekannt dafür, akribisch Tatorte zu dokumentieren und zu analysieren. Auch seine Vorgehensweise mit sogenannten “Mordakten” – eine standardisierte Sammlung aller relevanten Informationen zu einem Fall – war völlig neu und wurde später in vielen Polizeibehörden übernommen. Auch in meinem Roman gibt es auf Grund dieser Entwicklungen eine große Archivumstellung in der Polizeistation Geldern.
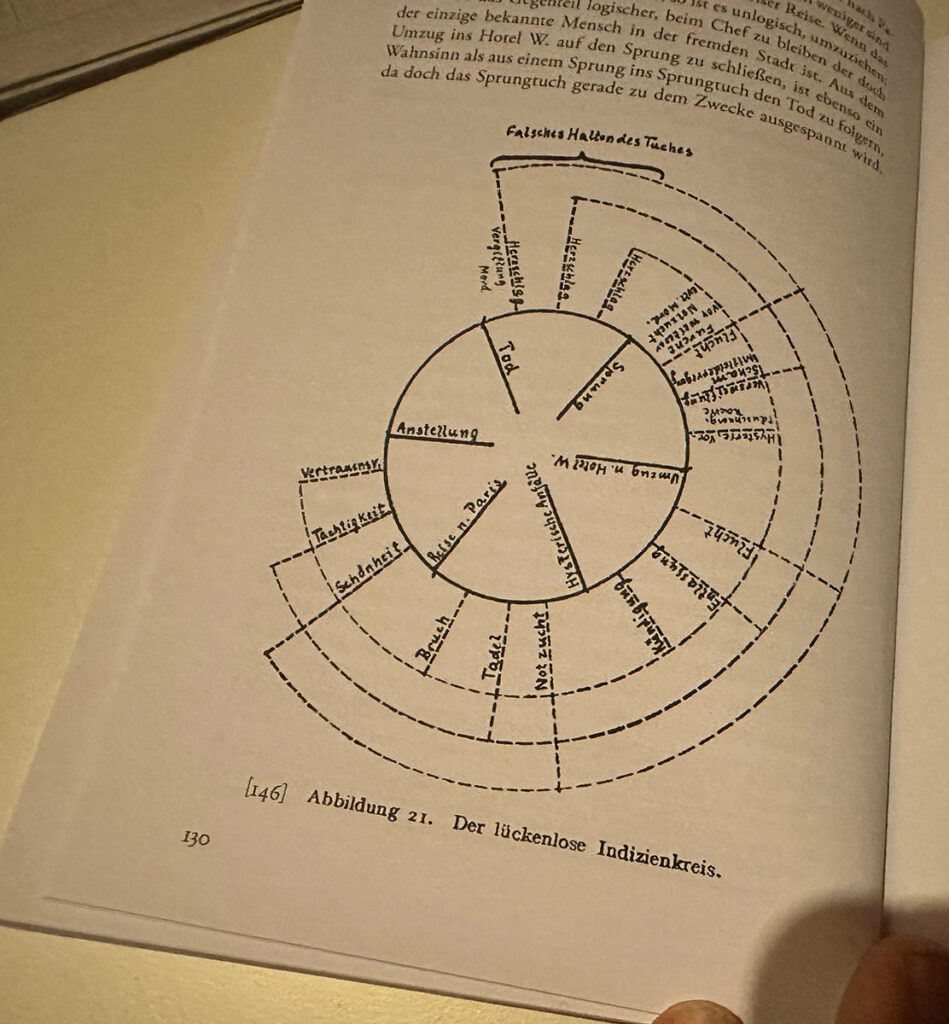
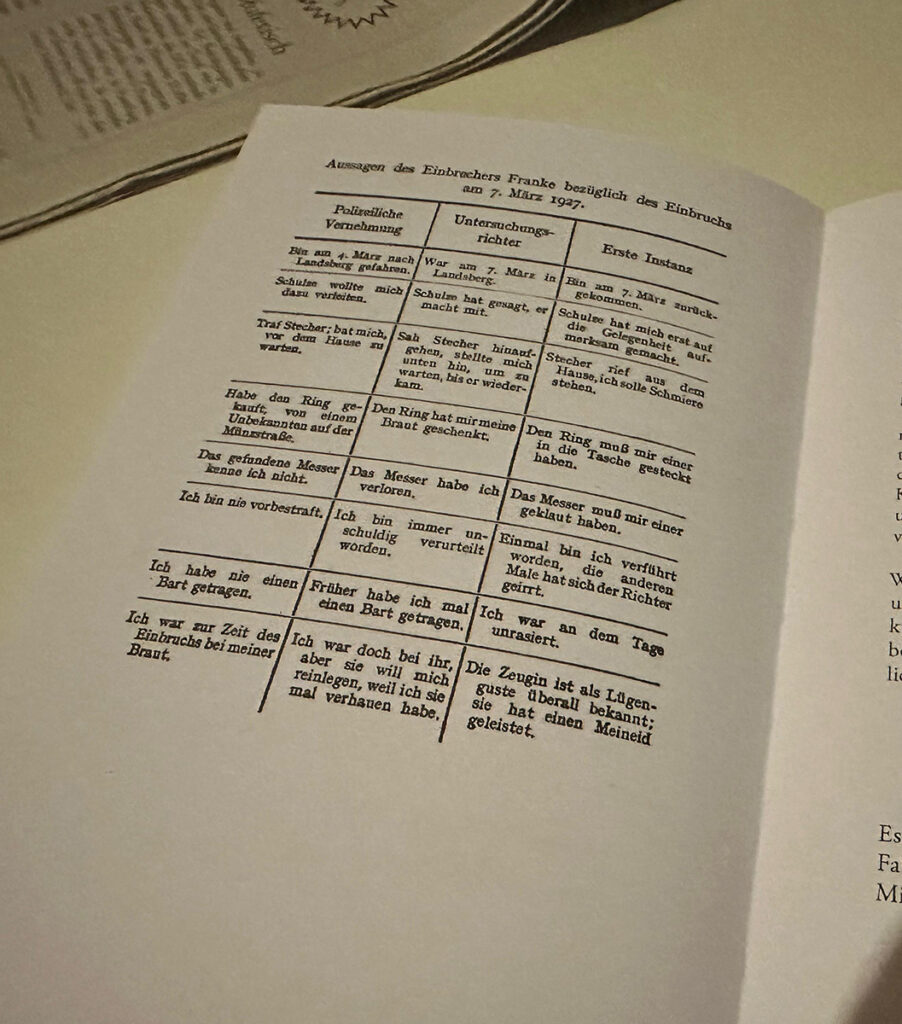
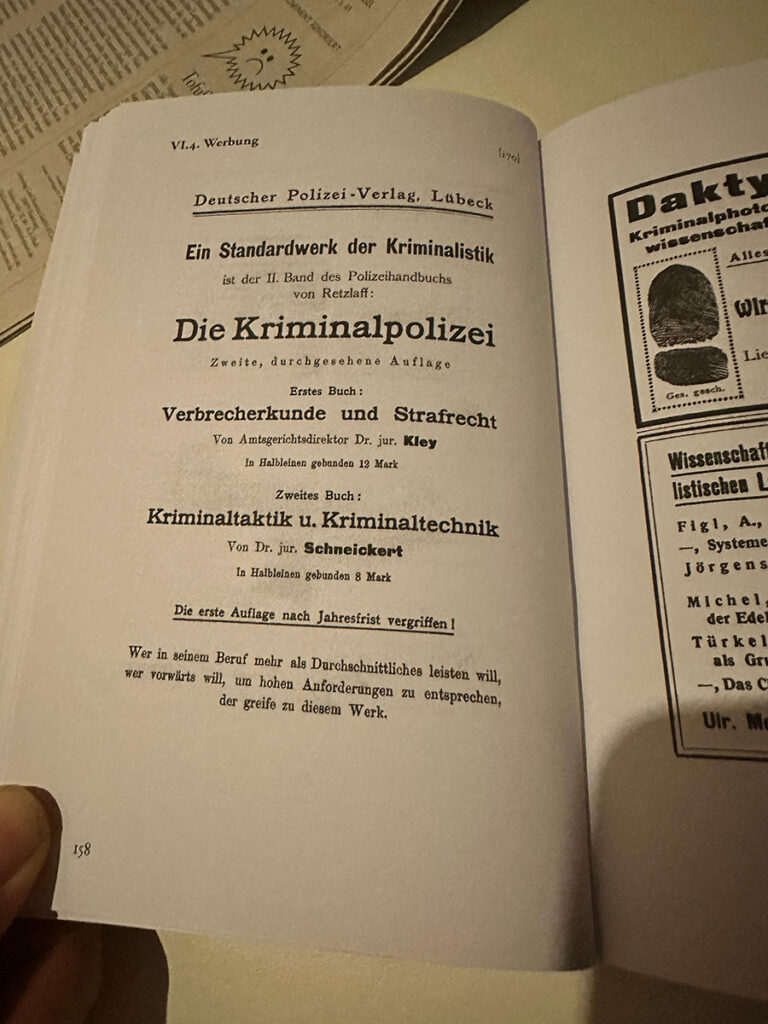
Gennat war laut Ausführungen äußerst pflichtbewusst und war beliebt bei Kollegen und Journalisten. In den Zeitungen jener Jahre wurde er schnell zu einer Art Kultfigur, die von der Bevölkerung “der Buddha” genannt wurde. Eine Anspielung auf seine Leibesfülle und seine ruhige Art. Das Buch widmet sich sowohl der Person als auch den Strukturen, die er geschaffen hat. Es ist kein trockener Fachaufsatz, sondern ein sehr zugängliches, populärwissenschaftliches Werk, das aufzeigt, wie spannend die frühen Jahre moderner Polizeiarbeit in Deutschland tatsächlich waren.
Besonders gefallen hat mir, dass auch einige Fälle, die Gennat bearbeitet hat, erzählt werden. Man bekommt nicht nur einen Einblick in die Arbeit der Mordinspektion, sondern auch in das Berlin der 1920er Jahre. Eine Stadt, die damals als pulsierende Metropole Europas galt (und die ich daher sehr gerne in meinen historischen Rollenspielrunden als Szenario wähle).
Natürlich darf man dabei nicht vergessen, dass die Fortschritte, die Gennat und seine Mordinspektion in Berlin etablierten, auf dem Land im Jahr 1927 noch längst nicht 1:1 angekommen waren. In Geldern und Umgegend herrschten nach wie vor ganz andere Strukturen, oft geprägt von knappen Ressourcen, fehlender Spezialisierung und einer eher handfesten, pragmatischen Herangehensweise an Verbrechen. Wie ich bereits in einem meiner vorherigen Romantagebücher beschrieben habe (hier klicken), waren es einzelne Schutzleute oder kleine Gendarmerieposten, die mit den Mitteln des Alltags bei ihrer Polizeitätigkeit zurechtkommen mussten.
Wer also schon immer mal wissen wollte, wie man vor hundert Jahren einen Mord aufgeklärt hat und welche Rolle Ernst Gennat dabei spielte, der sollte zu diesem Buch greifen. Es lohnt sich.
Für die kommende Woche nehme ich mir die weitere Bearbeitung einiger Szenen vor; diese sind aber eher formaler Natur. Aber ich hoffe, ich kann dann wieder eine aktualisierte Fortschrittsgrafik anbieten. Euch einen guten Start in die Woche!